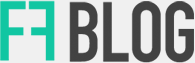|
Weltempfänger
Stärker denn je leben tagesaktuelle Nachrichten von Bildern. Die meisten Print-, Fernseh- und Internetmagazine vertrauen vorrangig auf die Kraft des Visuellen, ja weisen ihr in der Berichterstattung häufig die höchste Bedeutung zu und erweitern den reinen Informations- um einen ästhetischen Gehalt. Doch welche Formen der Inszenierung sind dabei zu beobachten? Welche Darstellungsweisen setzen sich durch? Wozu führt es, wenn die Zahl der Bildproduzenten immer weiter steigt? Warum sind einzelne Nachrichtenbilder weltumspannend und erinnerungsprägend erfolgreich, und warum gelangen andere nicht über eine Lebensdauer von wenigen Stunden hinaus? Und nicht zuletzt: Gibt es so etwas wie eine „ikonische Formel“, nach der sich die Karriere eines Bildes bestimmen ließe? Wir haben Theoretiker eingeladen, diese Fragen an tagesaktuellen Bildern zu diskutieren. Es bloggen für uns u.a. die Bildwissenschaftler von „Bildfähig!“ Simon Bieling und Daniel Hornuff.
October 20th, 2009

Von Daniel Hornuff und Simon Bieling
Offenbar geht es unerbittlich zu: Wenn Miariam Meckel und ihre Partnerin Anne Will einen roten Teppich betreten, wird scharf geschossen. “Ich blicke in 100 Augenpaare”, so Meckel in einem Artikel, “versteckt hinter 100 Linsen. 300 Augen und Linsen starren zurück. Die gesellschaftliche Promenade hat die Form eines Spaziergangs, diese hier ist ein Spießrutenlauf”. Daher gäbe sie und ihre Partnerin bei derartigen Anlässen gerne “das Ballett der ungeschlüpften Küken” - meistens sei es aber schlicht ein “Kampf”, doch “als Paar koordinieren wir den Stress”. Oft habe sie schon mit dem Gedanken gespielt, die Hintertür zu nehmen. Doch das wiederum sei eine Form der Kapitulation: “Weil ich lieber versuchen möchte, mich zu wehren, mich vom reinen Objekt auch zum Subjekt der Betrachtung zu machen”.
Maultäschle hatten bisher gegenüber Miriam Meckel einen entscheidenden Nachteil: sie können den Spieß nicht umdrehen, sondern sind gezwungen, die Kameras zu ertragen, die sich rücksichtslos etwa auf chefkoch.de auf sie richteten. Doch nun hat die FAZ aufgrund eines richterlichen Urteils gezeigt, dass es auch anders geht: Auch Maultaschen haben das Recht auf ein Bild der Kamera, das sie fotografiert oder videografiert hat. Dabei fragt sich: Ist das schon eine Bildkritik? Beginnt hier der Fotojournalismus sich selbst zu kritisieren? Handelt es sich hier um eine Parallele zwischen der bildwerdenden Maultasche und Meckels Versuch, die Kritik an der Bildherstellung zu vollziehen, indem sie die Bilder der Kameras zeigte, die diese Bilder herstellten? Und muss es uns nicht stutzig machen, dass die Bilder wiederum in einer Zeitschrift, nämlich im SZ-Magazin erschienen?
Das Kamerabild ist in jedem Fall das visuelle Prädikat für die herausragende Bild-Bedeutung eines Gegenstands. Im fortgeschrittenen Zeitalter der Medienproduktion unterscheiden die Medien möglicherweise selbst zwischen Gegenständen, die sie einfach nur so zeigen und solchen, bei denen zusätzlich zur Sichtbarkeit gelangt, dass weitere Kameras anwesend waren.
Doch eine weitere Deutung ist möglich. Bei ihr kann uns Marquise de Pompadour helfen. Diese schminkte sich nämlich öffentlich, festigte damit ihr Prestige als ästhetisches, selbstgestaltetes Objekt und unterstrich – buchstäblich – ihr höheres Recht auf Künstlichkeit. Was die Marquise am Schminktischen in aller Öffentlichkeit tat, geschieht in ähnlicher Weise durch die Koalition zwischen Maultasche und Kamera: Wenn Bildmedien ihre Bildfähigkeit und Bildherstellungskompetenz von Zeit zu Zeit unterstreichen, so tun sie dies, indem sie ihre Instrumente und ihren Anspruch als visuelle Produktionsinstanzen buchstäblich ins Bild setzen.
Damit ist, so wäre der Gedanke zuzuspitzen, die Voraussetzung geschaffen, das Bildmotiv zu autorisieren. Wer visuell Zeugnis darüber abzulegen vermag, dass bereits die eigene Bildwerdung ästhetischen Ansprüchen genügt, muss sich um das Endergebnis wohl keine Gedanken machen. Demnach dreht Meckel den Spieß um, und berichtet über das Fotografiertwerden; die Relevanz der Maultasche wird dagegen durch eine beigestellte Kamera zertifiziert; und die Marquise erkannte die Bildpotenz, die ihrem eigenenVeredelungsprozess zu entlocken war. In allen Fällen macht sich also das Medium selbst zum Thema und liefert demnach Argumente für eine wohlwollende – anerkennende – Auswertung des Ergebnisses.
Tags: Ästhetik der Kamera, Maultaschen, Maultäschle, Miriam Meckel, Mme de Pompadour, Schwaben, Selbstinszenierung der Medien, Selbstreflexivität?
Uncategorized
No Comments »
October 12th, 2009

Von Simon Bieling
Abhebende Sporthelden, die per Bild in ewiger Schwebe bewahrt werden, um ihre Fähigkeiten zum Unmöglichen unter Beweis zu stellen und ebenso zu feiern, sind wohl bekannt. So ist es keine Übertreibung festzustellen, dass einst Michael Jordan seine gesamte Karriere auf den Aufnahmen aufbaute, die ihn fern des Erdbodens und unbedrängt von Konkurrenten zu präsentieren vermochten. (vgl. hier, hier und hier) So ist auch Kloses Salto der letzten Woche ein Sprung in die visuelle Sphäre der sportlichen Lufthelden, ein Versuch, sich im Bild von der Realität des Fußballplatzes unabhängig zu präsentieren. Doch zuletzt gab es für Klose wenig Gelegenheit zum Torjubel fern des Rasens. Und auch der beißende Spott des strengen Vereinspräsidenten Franz Beckenbauers nach einem verpatzten Torsalto mit Verletzungsfolgen, hat Kloses Versuch, sich dauerhaft visuell als Luftprominenz zu platzieren in weite Ferne gerückt.
Der Sprung in die Luft ist visuell nicht auf den Sport begrenzt und Kloses Saltojubelszenen knüpfen an längere Bildtraditionen an. Bekannt sind etwa die Aufnahmen des Fotografen Philippe Halsman. Seit er Edsel Ford und deren Schwiegertocher in den fünfziger Jahren und später Marylin Monroe, Walter Gropius oder Brigitte Bardot zum Sprung vor der Kamera überreden konnte, hielt ihn nichts mehr davor zurück, sich selbst den Titel eines Jumpologisten zuzuerkennen (vgl. dieses Buch). Die einst von Halsman zur Starinszenierung genutzte Bildidee hat aber offensichtlich auch Eigenschaften, die sie als Bildmodus für Bildgemeinschaften auf flickr attraktiv machen. Sie ist einfach, prägnant und ohne viele Schwierigkeiten und Fähigkeiten jederzeit wiederherzustellen und weiterzuentwickeln. Das hat ihr auf flickr eine große Anhängerschaft beschert.
Kloses ritualisierter Luftauftritt und saltobasierte Jumpologie sieht sich so gleich dreifacher Konkurrenz ausgesetzt. Gegenüber Jordan wirkt seine in der Luft präsentierte Kugelsprung eher behäbig und daher Jordans beinah sorgfältig choreografiert wirkenden Sprungfiguren im Luftraum unerreicht. Um andererseits mit den eher am Bildwitz als an sportlicher Dynamik orientierten Starbildern Halsmans mithalten zu können, fehlt Klose jedoch wiederum die Fähigkeit, leicht und elegant im Bild zu erscheinen. Im Bild wirkt es, als ob Klose in jeder Faser Anstrengung vollbringen müsste, um den Salto auszuführen. Für die flickr-Nutzer wiederum ist dagegen ein anderer Nachteil offensichtlich: im Gegensatz zu Halsman eignet sich der Bildsprung Kloses natürlich kaum zur einfachen Adaption und Nachahmung. Mit einer Bildkarriere auf flickr wird Klose kaum rechnen können.
Kloses Torsalto konnte so in den letzten Tagen nur deshalb Erwähnung finden, weil sein Sprung auf bereits vorbereitetes Aufmerksamkeitsterrain traf (vgl. die Tageszeitungen hier, hier, und hier). Auch bei häufigerem Torerfolg bei Klose und auch dann wenn Klose nun doch wieder bei jedem Tor im Stadion die Luftkugel aufführte, ist jedoch unsicher, ob der Salto geeignet ist, als prägnantes und überzeugendes Markenzeichen zu fungieren. Bei Klose sind visuelle Zeichen eines sportlichen Helden mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten und dennoch leichtfüßiger Eleganz nicht zu entdecken.
So hat Klose zwar verstanden: Wenn schon bald jeder per Bild in der Luft zu stehen in der Lage ist, muss die Bewegung in der Luft beim Spitzensportler schon einiges an Raffinesse, Kompliziertheit und Wagemut aufweisen, dass das entstehende Bild noch für Titelseiten und Fernsehaufnahmen geeignet ist. Dennoch bedarf es zusätzlich der Eleganz und der visuellen Dynamik. Dem ohnehin schon derzeit eher erfolglosen Klose könnte also möglicherweise in Zukunft noch mehr Spott zukommen, wenn er nicht bald zu einer bildaffineren Jumpologie findet oder die Inszenierung des Jubels mit anderen besseren Bildmitteln fortsetzt.
Bildquelle: hier.
Mehr zu Halsman: hier.
Tags: Fußballbilder, Halsman, Jordan, jumpology, Klose, Salto, Sport, Torjubel
Uncategorized
No Comments »
October 5th, 2009

Von Simon Bieling
Vor Kurzem wies der kanadische Kulturwissenschaftler Grant McCracken auf den folgenreichen Lapsus einer Werbeagentur hin. Ein Schauspieler war für einen Werbespot für IBM engagiert worden, der kurz zuvor für Castrol Motor Oil aufgetreten war. McCracken gibt hinsichtlich des Falls zu bedenken, dass ein Unternehmen wie IBM durch Einsatz des gleichen Schauspielers in Vergleichszusammenhänge gebracht wird, von denen es sich eigentlich distanzieren möchte.
Ähnliche Probleme gibt es jedoch auch in anderen Bereichen, etwa in der Politik. Politiker sind Figuren in der medialen Öffentlichkeit, die ihr Bild stets nicht nur zu verschiedensten Kontexten kontrollieren, sondern auch stets einberechnen müssen, dass jeder Bildauftritt Auswirkungen jeweils darauf hat, wie folgende bewertet werden. Politische Karrieren sind heute nur dann erfolgreich zu gestalten, wenn der Ausgestaltung eines Bildnarrativs höchste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Es handelt sich für Politiker weniger darum, allein bei einzelnen Auftritten besonders überzeugend im Bild zu erscheinen. Vielmehr muss der jeweilige Auftritt im Zusammenhang eines Narrativs verschiedenster Bilder sinnvoll erscheinen. Entsprechend zeigte sich Guido Westerwelle am letzten Sonntag in triumphalen Posen. Halb seinen Anhängern zuwinkend, halb den eigenen Wahlgewinn über die unterlegenen politischen Gegner anzeigend, reckt er entsprechend des Anlasses seine Arme zur Triumphgeste empor (vgl. auch den griechischen Wahlsieger Papandreou). Beinah eine Woche später zeigt er sich mit Merkel vor dem Hintergrund des mit Kunst geschmückten Kanzleramts schon gelassener und mit weniger Expressivität. Dennoch beurteilen wir die Aufnahmen Westerwelles und Merkels im Kanzleramt weniger für sich, sondern noch im Zusammenhang mit den Bildinszenierungen des Wahlabends. Ein politisches Porträt in Serie wird so von beiden Parteien durch die Medien entwickelt: Die triumphierenden Porträts der einen Woche ergänzen und unterstützen gleichsam die gelasseneren Porträts im bundesrepublikanischen Machtzentrum des Kanzleramts in ihrer Überzeugungskraft.
Auch die unterlegene SPD, nach der Wahl dem Recht auf triumphale Bildgesten überdeutlich entbunden, ist selbstverständlich vor die Herausforderung gestellt, Porträtnarrative ihrer politischen Spitzenkräfte zu gestalten. Noch bevor Sigmar Gabriel im November zum Parteivorsitzenden kandidiert, ja nominiert worden ist, konfrontiert ihn die Bildzeitung schon mit einer Porträtgalerie der bisherigen SPD-Vorsitzenden. Die Zeitung fordert ihn damit heraus, es mit der Porträthistorie der SPD-Vorsitzenden aufzunehmen. Gabriel ist so bereits vor seiner Wahl aufgerufen, sich und sein Bild von den Bedeutungen zu differenzieren, die wir mit den ehemaligen Vorsitzenden der Partei verbinden. Der Wechsel an der Spitze der Partei wird damit nicht nur ein personeller Wechsel sein. Er ist nicht zuletzt auch ein ‘Bildwechsel’, mit dem die Hoffnung verbunden ist, an das Porträtnarrativ des SPD-Vorsitzenden neue Bedeutungen anzuknüpfen. Bezüglich flickr hat Gabriel übrigens besonderen Aufholbedarf: Ob er bald wie Merkel, die seit Kurzem mit einer ihr gewidmeten Gruppe unter dem Titel Merkelizer auftrumpfen kann, mit einer Gruppe mit dem Namen Gabrielizer rechnen kann, ist fraglich.
Neben der parlamentarischen Opposition wird sich Gabriel so auch um eine erfolgreiche Bildopposition zu bemühen haben, eine Sorge, die Guido Westerwelle nicht teilt. Er arbeitet dagegen bereits emsig daran, sein Bildnis dem Porträtnarrativ des Außenministers anzupassen: Sein „Bildgipfel“ zur Rekonstruktion einer historischen Aufnahme mit Hans-Dietrich Genscher, hat trotz seiner öffentlichen Zurückhaltung gleichsam indirekt seinen Anspruch mehr als deutlich gemacht. Westerwelles vorauseilende Bildstrategie fußt auf dem Verdacht, dass demjenigen, der im Bild dem früheren Außenminister schon vor zwanzig Jahren schon so nahe war und es heute wieder ist, man den Posten trotz Schwächen in der englischen Sprache kaum abschlagen kann. Ob dies Erfolge zeitigt, wird abzuwarten sein.
Bildquelle: Die Presse, hier.
Uncategorized
1 Comment »
September 29th, 2009
 1 1
Von Daniel Hornuff
Wenn die Wahllokale schließen, werden sie gezeichnet: Aus Nulllinien fahren bunte Balken, Segmente ordnen sich zu Halbkreisen, Kurven schlängeln sich durch Raster. Keinem konstruktivistischen Werk fieberten jemals auch nur annähernd derart viele Menschen entgegen. Die Übersetzung des Bürgervotums in geometrische Grundformen gehört zu den erstaunlichsten visuellen Phänomenen eines Wahlsonntags.
Dass nahezu alle Internet-, Print- und Fernsehberichterstattungen mittlerweile dazu übergegangen sind, Wahlprognosen und -hochrechnungen nicht auschließlich in Zahlen, sondern mithilfe grafischer Darstellungen zu veröffentlichen, mag kaum verwundern. Schließlich werden so auf einen Blick die wesentlichen Größenverhältnisse evident. Gleichsam jedoch scheinen sich dabei zwei konträre Erwartungen zu vereinen: Immerhin arbeitet das Diagramm – etwa im Gegensatz zum Symbol – mit einer gänzlich abstrakten Formsprache und vermittelt dennoch für Millionen eine konkrete Aussage. Die Abstraktion erreicht damit eine Evidenzkraft, die gemeinhin nur gegenständlichen Darstellungen zuerkannt wird. Wer also als Bildwissenschaftler einen Wahlausgang verfolgt, darf sich guten Gewissens zu grundsätzlichen Fragen veranlasst fühlen: Sind Diagramme eigentlich Bilder?
Tatsächlich wird mit diesem Themenkomplex eine der zentralen bildtheoretischen Konfigurationen berührt. Denn es scheint plausibel, dass Diagramme keinen unmittelbaren Realitätsbezug aufweisen, da sie in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu einer allgemein bekannten Sache stehen. Ein Diagramm besitzt entgegen einer gegenständlichen Darstellung kein Bildobjekt, das auf eine Sache außerhalb des Gezeigten verweisen würde.
Und dennoch beziehen wir uns bei der Betrachtung eines Diagramms auf etwas – wie beispielsweise auf die prozentual erreichten Stimmen einer Partei. Dieser Bezug findet jedoch nicht auf der Grundlage eines Ähnlichkeits-, sondern auf der Basis eines Strukturverhältnisses statt. Es gibt keine visuell nachvollziehbare Nähe zwischen Balken und Wählervotum, wohl aber eine strukturelle Entsprechung.
Der Bildphilosoph Lambert Wiesing formulierte es so: „Bei einem Bild haben wir die Ähnlichkeit sichtbarer Weise, hingegen besteht bei einem Diagramm die Ähnlichkeit ausschließlich in den Beziehungen“. Folglich weisen Bild und Diagramm jeweils unterschiedliche sichtbare Eigenschaften auf. Die Wissenschaft differenziert hier zwischen einem wahrnehmungstheoretischen und einem zeichentheoretischen Gebrauch. Ein Bild verkörpert demnach ein Wahrnehmungsphänomen, da mit ihm etwas zur Sichtbarkeit gelangt, was physisch nicht anwesend ist. Ein Diagramm hingegen ist niemals aus sich selbst heraus als Repräsentant eines Abwesenden zu verstehen. Es benötigt eine allgemein verständliche Zutat, wie etwa die Tönung in den bekannten Parteifarben. Erst damit, wo wäre ein Begriff von Wiesing zu übernehmen, kann ein „Nachbau von Strukturähnlichkeiten“ ermöglicht werden.
Textquelle: Ornament, Diagramm, Computerbild – Phänomene des Übergangs. Ein Gespräch der Bildwelten des Wissens mit Lambert Wiesing (geführt von Birgit Schneider, Margarete Pratschke und Violeta Sánchez), in: Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, Band 3,1: Diagramme und bildtextile Ordnungen, hrsg. von Horst Bredekamp, Birgit Schneider und Gabriele Werner, S. 115-128.
Bildquelle 1: Screenshot des vorläufigen amtlichen Endergebnisses vom 29.9.2009 auf RTLaktuell.de, siehe hier.
Tags: Bildtheorie, Bundestagswahl 2009, Diagramm, Wahlergebnis
Uncategorized
No Comments »
September 20th, 2009

Von Daniel Hornuff
Die Macht der Bilder ist ein oft gebrauchter Topos. Meist wird er von pessimistisch gestimmten Gemütern herangezogen, wenn signifikante – leicht wiedererkennbare – Bilder weite Teile der medialen Berichterstattung dominieren. Viele fühlen sich dann angehalten, in der offensichtlichen Präsenzstärke Hinweise auf eine Kraft zu erkennen, die den Bildern selbst entsteige und sie zum Erfolg pusche. Häufig wird dann eine ethische Zurückhaltung der Publikationsorgane angemahnt, mitunter sogar eine Verweigerung des Zeigens gefordert, um den visuellen Triebenergien nicht auch noch leicht zugängliche – multiplizierende – Präsentationsflächen zu offerieren. Denn was sich harmlos und verhalten kleide, offenbare sich allzu rasch als gefährliche Waffe. Die zur Schau getragene Schwäche verhülle eine inhärente Detonationskraft.
Wer die Nachrichtenbeiträge und rasch verfassten Kommentare zu dem kürzlich veröffentlichten, 25-minütigen Video des gebürtigen Marokkaners Bekkay Harrach verfolgt, kann diese in sich widersprüchlichen Einschätzungen wiederholt antreffen. Etwa beschrieb Florian Flade in der WELT „al-Quaidas deutsches Gesicht“ mit den Attributen braver Konfirmationsikonographie – „schulterlanges, gegeltes Haar, frisch rasiert, in Anzug mit Krawatte“ – und interpretierte auf dieser Grundlage einen „kühlen und berechnend agierenden Strategen des Terrors“, der eine „Drohkulisse“ mit „eiskalter Mimik und Gestik“ aufzubauen und „das Bild des westlichen, perfekt angepassten Gotteskriegers“ zu stärken verstehe.
Vor diesem Hintergrund muss überraschen, mit welch bildkompetenter Gelassenheit die Kultur der Privatästhetik reagiert. In Blogs und Internetforen, in Twitterbeiträgen und auf Videoplattformen fanden sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Videos zahlreiche Parodien, humoristische Anleihen und satirische Assoziationen. Offenbar fühlen sie sich nicht herausgefordert, die Oberfläche der Sichtbarkeit aufzureißen, um das Nicht-Sichtbare mit eigenen Befürchtungen auszugestalten. Sie tun hingegen das, was der Medienphilosoph Vilém Flusser 1989 ein „Scanning der technischen Bilder“ nannte: Ein Absuchen – „Entziffern“ – ihrer „Flächenhaftigkeit“ zwischen „jener Intention, die sich im Bild manifestiert, und jener des Betrachters“. Jede ikonische Ironie ist sich – auch implizit – dieser erkenntnistheoretischen Doppelnatur bewusst, da sie andernfalls keine Distanz zum Bild aufbauen könnte und folglich naiv über ein Unsichtbares spekulieren müsste.
Tatsächlich spitzte auch Flusser seine bildtheoretischen Ausführungen kulturkritisch zu: Bilder schöben sich zum Zwecke der Welterklärung zwischen den Menschen und die Welt und entzögen ihm folglich die Sicht auf die Realität: „Statt die Welt vorzustellen, verstellen sie sie, bis der Mensch schließlich in Funktion der von ihm geschaffenen Bilder zu leben beginnt. Er hört auf, die Bilder zu entziffern und projiziert sie statt dessen unentziffert in die Welt ´dort draußen´, womit diese selbst ihm bildartig – zu einem Kontext von Szenen, von Sachverhalten – wird“. Die Folge sei eine unheilvolle „Idolatrie“, eine Bilderverehrung.
Auch wenn Flusser damit ein gesamtkulturelles, apokalyptisch zugespitztes Untergangsszenario im Geiste der Simulationstheorie zeichnete, gewinnen seine Ausführungen im Zuge der aktuellen Terrorismusdebatte eine neue Relevanz. Schließlich bleiben Wendungen, die vom „Terror der Bilder“ orakeln, keine Seltenheit – und verbreiten ein mentales Klima, als dringe die Gewalt, jener „Kontext von Szenarien“ alleine schon durch die Medienkanäle in die Mitte der Gesellschaft ein. Oftmals wird mit solchen Hinweisen für die eigene intellektuelle Schärfe geworben, mit der Aufklärung in vernebelten Zeiten zu betreiben sei. Großmutig wird dann übersehen, dass die Gelassenheitskultur der Privatästheten vielfach bereits einen Schritt weiter ist – und praktisch anwendbare Bildkompetenzen entwickelt hat, die unter Anzug und Krawatte beim besten Willen kein Sprengsatzticken zu entziffern vermögen.
Bildquelle 1: Screenshot eines YouTube-Videos, siehe hier.
Weitere Informationen zu Vilém Flussers Theorie siehe hier.
Uncategorized
No Comments »
September 14th, 2009

Von Simon Bieling
Bilddateien sind keine Bilder, wie Claus Pias überzeugend klargestellt hat. Sie sind lediglich Möglichkeiten zu Bildern. Und erst seit es möglich ist, nur ‘Bildmöglichkeiten’ zirkulieren zu lassen, mithin elektronische Dateien, konnten sich jene digitalen Bildwelten entfalten, mit denen wir heute beinah täglich zu tun haben. Schon sind wir kaum noch überrascht, wenn wir in kürzesten Zeitabständen, identische Bilder in verschiedensten Bildumgebungen des Internets antreffen. Abgesehen von den erstaunlichen Zugriffsmöglichkeiten auf jegliche Art von Bildern, über die wir heute verfügen, ist jedoch auch eine andere resultierende Konsequenz von hohem Interesse. Wenn Bilder in großer Schnelligkeit zur Anzeige gebracht werden können, liegt es auch nahe, Bilder nicht mehr nach Begriffen, sondern wiederum nach Bildern zu ordnen. Sind die technischen Voraussetzungen deshalb gegeben, ist es kaum verwunderlich, dass dafür mit Panoramio und flickr schon erste Beispiele vorliegen. Sie machen gleichsam die Galeriebilder David Teniers’ aus dem 17. Jahrhundert auf überraschende Weise alltagstauglich.
Trotz historischer Vorläufer sind wird jedoch noch weitgehend ungeübt darin, Bilder uns auch in flächenhaften, bildlichen Strukturen verfügbar zu machen. Meist organisieren wir Bilder nach Kategorien oder auch in Chronologien im Fall von Nachrichtenbildern. Stets steht dabei der Wunsch im Vordergrund, unsere Bild-Präferenzen möglichst gut abzubilden und nach diesen, Bilder in ihrer Wichtigkeit zu bewerten und uns zugänglich zu machen. Je mehr wir aber wie heute beginnen, zentrale Überzeugungen, aufgrund derer wir unsere Handlungen koordinieren und uns Orientierungen verschaffen, auch auf Bildzusammenhänge zu stützen, scheint es angebracht, Bilder nach Bildern zu ordnen und nicht mehr nur nach thematischen und zeitlichen Gesichtspunkten.
Aus diesen Gründen sind die verschiedenen aktuellen Versuche Bilder in Bildkarten zu verorten von so hohem Interesse und nicht als einfache Spielerei abzutun. Sie sind insofern richtungsweisend als hier erste Versuche vorliegen, Bilder innerhalb von Bildern zur Unterscheidung anzuordnen. Dabei setzt jeder, der sich auf solchen “Bildkarten” zurechtfinden will, die Bildperspektiven der Satellitenbilder und der an verschiedenen Punkten auf diesen angeordneten Bilder in einen Wechselbezug zueinander. Wer hier sich auf Bildersuche begibt, wird differierende Perspektiven auf einen übereinstimmenden Bildgegenstand zurückführen. Das ist die Voraussetzung: Nur dann wird man bestimmte Bilder bestimmten Orten und bestimmte Orte bestimmten Bilder zuordnen können.
Mit den “Bildkarten” dieser Art deutet sich das Entstehen neuer Bildkonventionen an, die derzeit noch allein vom Luftbild erfüllt werden. Zu erwarten sind neue Bildmodi, die nicht etwa Darstellungen von Ereignissen oder Personen zur besseren Lesbarkeit standardisieren, sondern sich zur Organisation und Unterscheidung anderer Bilder besonders gut eignen. Über sie zu verfügen, könnte dabei nicht zuletzt auch von einem nicht geringen ökonomischen Interesse sein – wie derzeit durch Google schon deutlich wird. Welche Bildproduzenten sich dabei durchsetzen, wird jedenfalls durch die Fähigkeit entschieden werden, Bilder danach beurteilen zu können, ob sie aufgrund ihrer Gestaltung bestimmte Überblicksfunktionen besser oder schlechter erfüllen. Dass Luftbilder dafür zunächst naheliegende Kandidaten sind, liegt auf der Hand. Ihre Prädisposition, Bilder an bestimmte Orte zu knüpfen, bildet jedoch nur ein mögliches Organisationsprinzip, das visuell angelegt werden kann. Nichtsdestoweniger regen sie schon heute dazu an, Orte verstärkt nach ihrer Fotogenität zu beurteilen und zugleich Bildvarianten identischer Bildgegenstände einem vergleichend differenzierenden Urteil zu unterziehen.
Quellen:
Abbildung: Bildschirmfoto, 14. September 2009, hier.
Claus Pias, “Das digitale Bild gibt es nicht – Über das (Nicht-)Wissen der Bilder und die informatische Illusion,”
in: zeitenblicke 2, Nr. 1, 2003, hier.
Ebenso zu diesen Fragen:
Stefan Heidenreich, “Drei Thesen zum Iconic Turn,” www.iconic-turn.de, 3. 1. 2009, hier.
Tags: Bildarchive, Bilddatei, Bildkonventionen, Panoramio, Pias, Teniers
Uncategorized
No Comments »
September 7th, 2009
 1 1  2 2Von Daniel Hornuff
Michael Jacksons Beerdigung blieb den Blicken der Weltöffentlichkeit weitgehend entzogen. Nur einzelne Fotos und Filmaufnahmen– meist diffus und kaum entzifferbar, die Mehrzahl zusätzlich aus großer Höhe geschossen – fanden Eingang in die mediale Berichterstattung. Als der weltliche Körper des Königs schließlich zu Grabe getragen wurde, blendeten sich entsprechend dem Familienwunsch auch die letzten Sender aus. Schließlich gehört die – symbolische – Unvergänglichkeit zum konstitutiven Wesensmerkmal eines Königs; sie soll nicht durch allzu definitives Sargversenken geschwächt werden. Dass sie entgegen der Absicht dennoch begraben wurde, zeigt der Blick auf eine kurz darauf eröffnete Auktion, deren Zeitpunkt nicht passender hätte gewählt werden können:
Im australischen Melbourne wurde nur zwei Tage nach der Bestattung – am 5.9.2009. – das erste Element der vermeintlichen Unsterblichkeit durch das Auktionshaus Bonhams and Goodman versteigert. Es handelte sich um einen Glitzerhandschuh – zu Jacksons Hochphase sein vielgerühmtes Markenzeichen –, konkret um jenes Exemplar, das er bei seiner Hochzeit mit Debbie Rowe getragen und bei einem nachfolgenden Konzert ins Publikum geworfen haben soll. Demnächst wird es in der Las-Vegas-Hard-Rock-Hotel-Sammlung neben Erinnerungsstücken von Elvis Presley ausgestellt sein.
Wer am vergangenen Wochenende die Medienberichterstattung aufmerksam verfolgte, konnte so einer eigenartigen Verkehrung kollektiver Bilderwartungen gewahr werden: Das buchstäbliche Ausblenden des Bestattungsmoments wurde ersetzt durch die massenmediale Verbreitung eines Bildes, das in nachdrücklicher Evidenz an Damian Hirsts „For the Love of God“ erinnert. Tatsächlich liegt eine Gemeinsamkeit zwischen dem funkelnden Handschuh und dem diamantbesetzten Totenschädel in der Entfaltung einer fotogenen Wirkungsästhetik, die das jeweilige Sujet aus einem schwarzen Hintergrund konturscharf herausschneidet und bis hinein in einzelne Lichtreflexionen mit der Aura eines Mehrwerts veredelt. So scheint offensichtlich, dass Jackson und Hirst jeweils ein optisches Signifikat wählten, das erst in seiner eigenen Fotoreproduktion zur eigentlichen Bildkraft zu gelangen vermag.
Jacksons Tod, der bereits heute sämtliche Konturen des Mystischen trägt, wird folglich durch ein individuelles und zugleich königliches Attribut überdauert, das zeitlebens in bekannter Pose am maskulinen Allerheiligsten fühlen durfte. Ähnlich Hirsts Arbeit schimmert hier die Bildinszenierung einer Erhabenheit auf, die als Manifestation eines Transzendenzanspruchs gelten will.
Doch diese Bildkonfrontation konturiert die – entscheidende – Differenz: Hirsts Totenschädel legitimiert sich vor allem durch den erzielten Preis, den der Künstler als Teil der Investmentgruppe bekanntlich selbst mitgestaltete. Der Totenschädel ist das Objekt eines Kunstverständnisses, das sowohl bereits in der Romantik als auch in der Avantgarde auf das Postulat des ´radikal Anderen´ setzte. Hirst realisierte einen ästhetischen Ausnahmezustand folglich mittels des Auktionsertrags von 50 Millionen Pfund. In einem buchstäblich unfassbaren Surplus also, das Jacksons Handschuh fehlt: Obwohl die Erwartungen der Auktionatoren um das Doppelte übertroffen wurden, kam er umgerechnet nicht über vergleichsweise magere 34.000 Euro hinaus.
Kann also Hirst durch den Preis das Erhabenheitspostulat eindrücklich entfalten und damit an das für die Kunst der Moderne charakteristische Unermesslichkeitsgebaren anknüpfen, so zerfällt Jacksons Unendlichkeitsanspruch – erneut – beim Thema Geld. Obwohl die visuellen und symbolischen Voraussetzungen gegeben und damit die popkulturellen Erfolgsbedingungen eingelöst schienen, verweltlicht und relativiert der Preis den erhofften Unsterblichkeitsgewinn fatal. Der diamantbesetzte Totenschädel hingegen designed den Kapitalismus über den symbolischen Tod hinaus und verspricht damit tatsächlich einen überdauerenden Mehrwert, der selbst herrschenden Wirtschaftsordnungen noch eine artifizielle Gestaltkraft abzuringen vermag. Jackson hingegen schien als passionierter Autoplast die Idee der Vanitas zu sehr inkorporiert und damit auch ihren Symbolgehalt der definitiven Vergänglichkeit preisgegeben zu haben.
Bildquellen: 1 Michael Jackson, Handschuh, aus: AFP, siehe hier; 2 Damian Hirst, For the Love of God, siehe hier.
Tags: Ästhetik der Erhabenheit, Damian Hirst For the Love of God, Michael Jackson Handschuh
Uncategorized
No Comments »
| 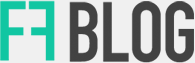
|


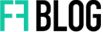


 1
1

 1
1  2
2